Wohnbau in Österreich : Kritik an überlangen Bauverfahren
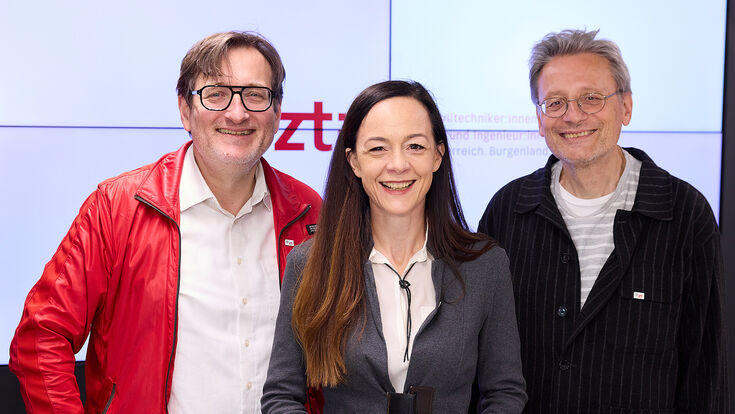
Kammerpräsident Bernhard Sommer, Sophie Ronaghi-Bolldorf, Vorsitzende des Ausschusses Bauordnung der zt: Kammer und Peter Bauer, Vizepräsident der zt: Kammer (v.l.n.r.)
- © zt: KammerDie Ziviltechnikerkammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland schlägt in einer Pressekonferenz Alarm: Bauverfahren in Wien dauern zunehmend länger – mit weitreichenden Folgen für Wohnbau, Wirtschaft und Klimaziele. Eine aktuelle Umfrage unter ihren Mitgliedern zeigt, dass bei über einem Drittel aller Projekte die Genehmigung länger als ein Jahr dauert. Etwa 29 Prozent der Bauverfahren werden innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen, obwohl dies laut Verwaltungsverfahrensgesetz die Regel sein sollte. „Überlange Bauverfahren verursachen volkswirtschaftliche Schäden und können Existenzen kosten", fasst Kammerpräsident Bernhard Sommer zusammen.
Die volkswirtschaftlichen Folgen sind laut Kammer massiv: Ein Gegenwert von rund 400 Wohnungen jährlich gehe durch Verzögerungen verloren, was wiederum die Miet- und Immobilienpreise weiter anheizt. Auch die Bauwirtschaft leide unter gebundenem Kapital, Planungsunsicherheit und steigenden Finanzierungskosten. Verzögerungen behindern zudem die Klimaziele, etwa durch das Ausbleiben von thermischen Sanierungen oder Solarausbau. Außerdem sei die Pressekonferenz als „Hilferuf für viele Planungsbüros" zu sehen, deren Honorare sich durch lange Verfahrensdauern verringern würden.
>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!
Umfrage: Dauer von Baugenehmigungen nahm zu
Die Kammer der Ziviltechniker*innen hat 2023 eine Umfrage unter ihren Mitgliedern durchgeführt, da es vermehrt zu Beschwerden über lange Verfahrensdauern im Bereich der Länderkammer Wien, Niederösterreich und Burgenland kam, insbesondere in Wien. Damals konnten in Wien immerhin 33 Prozent der Projekte innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen werden. Zum Vergleich: In Niederösterreich konnten 2023 78 Prozent der Verfahren innerhalb von 6 Monaten beendet werden, im Burgenland sogar 89 Prozent.
2025 wurde erneut eine Umfrage mit den gleichen Fragen durchgeführt. Laut den Rückmeldungen hat sich die Situation in fast allen Bereichen und allen drei Bundesländern verschlechtert. In Wien konnten 29 Prozent der Projekte innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen werden, in Niederösterreich 65 Prozent und im Burgenland 76 Prozent. 33 Prozent der Projekte, die derzeit in Wien genehmigt werden, hatten eine Verfahrensdauer von über einem Jahr. Zum Vergleich: In Niederösterreich waren es 7 Prozent und im Burgenland 6 Prozent.
Bei der Umfrage wurde keine exakte Verfahrensdauer erhoben. Aufgrund der Komplexität der Baugesetze und -normen kann es auch durch Nachforderungen zu gerechtfertigten Verzögerungen kommen. Immerhin gaben die teilnehmenden Ziviltechniker*innen durchaus zu, dass Ergänzungen erforderlich und gerechtfertigt waren, und zwar bis zu 40 Prozent in Wien. Ebenfalls in Wien geben allerdings 20 Prozent der Befragten in fast allen Planungsfeldern an, dass aus ihrer Sicht der Irrtum bei der Behörde lag. Ein Wert, der in Niederösterreich und im Burgenland besser ausfällt.
Verpflichtende Ziele von der Politik gefordert
Die Kammer betont aber auch, dass sie bereits nach der ersten Umfrage 2023 in einen konstruktiven Dialog mit der Behörde eintreten konnte. Viele Projekte konnten durch eine Änderung des Verwaltungsablaufs abgeschlossen werden, und die Bauphysik, die damals ein Nadelöhr war, wurde personell aufgestockt. Die Beschwerden nahmen anfangs rapide ab, hätten sich aber danach wieder gehäuft – deshalb sei eine Priorisierung des Themas bei den politisch Verantwortlich auch so wichtig.
„Diese Priorisierung wurde uns auch bereits zugesagt. Als zt: Kammer müssen wir aber dafür Sorge tragen, dass die Dringlichkeit dieses Themas im Zuge der Regierungsbildung nicht in den Hintergrund gerät", wie die zt:Kammer schreibt. Peter Bauer, Vizepräsident der zt: Kammer, fordert daher verbindliche Ziele zur Reduktion der Genehmigungsdauern von Bauprojekten im Regierungsprogramm. Ein Grund für die langen Verfahren sei der immer komplexer werdende Baubewilligungsprozess. Die quantitativen und qualitativen Anforderungen an Gebäude nehmen zu – und damit auch der Prüfaufwand. So führen zum Beispiel die Klimaziele der EU notwendigerweise zu zusätzlichen Auflagen, Richtlinien und Normen.
„Wir sind im guten Dialog mit der Verwaltung und erkennen, dass bessere Verfahrenskoordination und lösungsorientierte Prüfung Potenziale sind, die schon jetzt auszuschöpfen sind“, bestätigt auch Sophie Ronaghi-Bolldorf, Vorsitzende des Ausschusses Bauordnung der zt: Kammer. Die Kammer legt dazu Reformvorschläge vor, darunter eine bessere Koordination zwischen den beteiligten Magistratsabteilungen, klare Prüfkriterien, einen digitalisierten und transparenten Verfahrensablauf sowie die Stärkung der verfahrensleitenden Behörden. Dazu sollen auch die Planer*innen einen Beitrag leisten: durch die Mitarbeit an den Leitfäden oder sonstigen Hilfestellungen und durch die Informationsweitergabe.
>>> Bauen außerhalb der Norm in Österreich: Bewegung beim „Gebäudetyp Ö“
Reformvorschlag für Wiener Bauordnung
Ein zentraler Reformvorschlag ist die Stärkung des § 70a der Wiener Bauordnung, der Ziviltechniker*innen als Prüforgane einsetzt, aber bislang kaum angewendet wird – unter anderem aufgrund rechtlicher Unsicherheiten, wie die Kammer moniert. Der Bauprozess müsse vereinfacht, Verwaltungsabläufe koordiniert und die Prüfkultur reformiert werden. Vorbilder wie das Hamburger Modell zeigen, dass mit Mut zur Strukturreform deutliche Verbesserungen möglich sind. „Außerdem muss die Bauordnung neu geschrieben werden“, fordert Sommer. Das Werk eigne sich nicht mehr für die Regelung des zeitgemäßen Bauens, und auch die digitale Transformation stockt: Die bald 100 Jahre alte Wiener Bauordnung lässt sich laut der Kammer kaum mit modernen Prüfroutinen kombinieren.
Das Hamburger Modell
Im Rahmen der Hamburger „Initiative kostenreduziertes Bauen“ haben über 200 Fachleute, Vertreter*innen der Praxis sowie Entscheidungsverantwortliche von rund 100 Institutionen der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand ein Jahr gemeinsam an einem zentralen Ziel gearbeitet: Die Baukosten im Wohnungsneubau nachhaltig zu senken.
In interdisziplinären Arbeitskreisen wurden rechtliche und bauliche Standards ebenso hinterfragt wie Planungs-, Verwaltungs-, Bau-, Management- und Ausführungsprozesse. Zu den identifizierten Kostentreibern wurden rechtssichere, praxistaugliche Abweichungsmöglichkeiten sowie neue Prozess- und Verfahrenslösungen entwickelt, um insbesondere den freifinanzierten Wohnungsbau wieder zu erleichtern. Um die Baukosten zu senken und den Wohnungsneubau nachhaltig zu beleben, wurden praxistaugliche Ansätze in drei übergeordneten Handlungsfeldern (kostenreduzierende Baustandards, optimierte Prozesse und Planung, beschleunigte Verfahren) entwickelt.
Aus den entwickelten Maßnahmen lassen sich insgesamt bis zu 2.000 Euro brutto pro Quadratmeter Wohnfläche einsparen. So könnten allein durch die Anwendung der angepassten Standards im Bereich Baukonstruktion und Gebäudetechnik die Baukosten um circa 600 Euro brutto pro Quadratmeter reduziert werden. Aus optimierten Prozessen und Verfahren – also aus dem Gewinn von Zeit sowie der Vermeidung von Planungswiederholungen – lassen sich weitere rund 400 Euro brutto pro Quadratmeter einsparen. Weiteres Einsparpotential in Höhe von bis zu 1.000 Euro brutto wird durch eine effizientere Planung, Vermeidung teurer Bauweisen und teurer technischer Anlagen sowie durch den Verzicht auf besonders aufwändige Bauteile wie Tiefgaragen erreicht.

