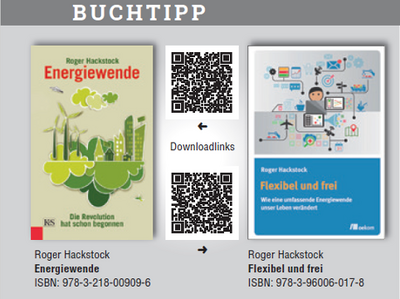Erneuerbare Wärme : Klimaneutrale Haustechnik als neuer Standard
Seit Anfang 2024 sind keine Gasheizungen mehr im Neubau erlaubt, für Ölheizungen gilt dieses Verbot schon länger. Damit gehört der Einbau von fossilen Heizungen in neu errichteten Gebäuden der Geschichte an. Das war auch höchste Zeit, da neue Kessel eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten haben und wir spätestens im Jahr 2040 klimaneutral sein wollen, also unabhängig von fossilen Energieträgern. Der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Heizungen hätte auch in Bestandsgebäuden beschleunigt werden sollen, das Erneuerbare-Wärme-Gesetz wurde aber von Seiten des konservativen Regierungspartners auf ein Gasheizungsverbot im Neubau geschrumpft, der Bestand blieb unberührt.
>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!
RED III und EBPD: EU-Richtlinien setzen neuen Rahmen
Ende des Jahres 2023 ist eine Erneuerbare-Energien-Richtlinie der Europäischen Union (Renewable-Energy-Directive, RED III) in Kraft getreten, die eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie in der EU auf 60 Prozent bis 2030 fordert, bei Wärme sollen die Erneuerbaren jedes Jahr um 1 Prozentpunkt zulegen. Allein mit einem Umstieg im Neubau ist dieses Ziel nicht zu erreichen, es wird auch im Bestand Verordnungen brauchen, um großflächig Investitionen in den Heizungstausch auszulösen.
Berechnungen des Verbandes Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) ergaben, dass der Anteil erneuerbarer Wärme in Österreich bis 2030 verdoppelt werden müsste, um die EU-Ziele zu erreichen. Eine wichtige Rolle spielen dabei Planer*innen und Handwerker*innen, die Haushalten und Betrieben zur jeweils besten Lösung beim Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter verhelfen. Denn der Ausstieg soll sich in hoher Qualität vollziehen, wofür es Profis braucht, die sich mit klimaneutraler Haustechnik auskennen. Als Unterstützung haben wir in Österreich auch das Austria Solar Gütesiegel, das beim Solaren Heizen längere Garantiezeiten bietet und geringere Energieverluste durch hocheffiziente Speicher und Pumpen verspricht.
Eine zweite EU-Richtlinie, die den Trend zu klimaneutraler Haustechnik beschleunigen wird, ist im Mai 2024 in Kraft getreten und regelt die Effizienz von Gebäuden. Die sogenannte EPBD-Richtlinie zielt auf einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050, da Gebäude für mehr als ein Drittel aller Treibhausgase in der EU verantwortlich sind. Ab dem Jahr 2030 soll es nur mehr „Zero Emission Buildings“ im Neubau geben, alle Gebäude der Energieklasse F und G müssen bis 2027 bzw. 2030 auf bessere Energieklassen saniert werden.
Solares Heizen hat das größte Potenzial
Das Ziel der EU-Kommission ist, die Wärmeversorgung Europas krisensicherer und preisstabiler zu machen, was weniger Abhängigkeit von ausländischen Energieimporten bedeutet. Das größte Energiepotenzial hat die Sonne, die derzeit nur zu einem Bruchteil genutzt wird. Aktuell sind auf 11 Millionen Dächern in Europa Solarwärmeanlagen installiert, die 40 Terrawattstunden Wärme pro Jahr liefern, das entspricht einem Viertel des Wärmebedarfs von Österreich.
Dabei ist das Energiepotenzial der Sonne enorm, hierzulande braucht sie nur 14 Stunden, um theoretisch den Jahresbedarf aller Haushalte und Betriebe an Wärme zu liefern. Österreich würde von einer Solarwärmeoffensive am stärksten profitieren, da 95 Prozent aller produzierten Kollektoren in den Export gehen, Solartechnik Made in Austria ist weltweit begehrt. Von Seiten der EU-Kommission kommen dazu klare Signale. In der EU-Gebäuderichtlinie ist ab 2026 eine Solarpflicht für alle Neubauten vorgesehen, die bis 2030 schrittweise ebenso für Bestandsgebäude gilt.
Obdorfpark: Vorzeigeprojekt im Wohnbau
Ein Beispiel für den künftigen EU-Standard in Gebäuden ist das Wohnprojekt Obdorfpark in Bludenz. Um die 50 Wohnungen mit Wärme und Strom zu versorgen, wird die Kraft der Sonne ebenso genutzt wie Wärme aus der Erde. Eine Solarwärmeanlage 49 kW Leistung (70 m² Kollektorfläche) deckt den Grundbedarf an Warmwasser und liefert Zusatzenergie zum Heizen, außerdem dient sie der thermischen Regeneration der Erdsonden.
Die hocheffiziente 83 kW Hochtemperaturwärmepumpe und die 1.610 Meter Erdsonden sichern die Wärmeversorgung im Winter, das Zusammenspiel aller Komponenten wird durch eine smarte Speicher- und Regelungstechnik gesteuert. Die 37 kW Photovoltaikanlage am Dach produziert mehr Strom als die Wohnanlage braucht, der Rest wird ins Netz eingespeist.

>>> Wärmepumpe goes Wohnung – aber wie?
Der Betreiber der Heizung ist die illwerke vkw, die das Wohnprojekt als Wärme-Contractor übernommen hat. Von ihr kamen Planung und Umsetzung, die Heizung wird für die nächsten 20 Jahre vom Contractor gewartet und betreut. Die Anlage ist seit sechs Jahren in Betrieb und hat die Erwartungen übertroffen, mit den hohen Energiepreisen der letzten beiden Jahre hat sich die Investition längst amortisiert. Die Mieter*innen können für die nächsten Jahre mit geringen und stabilen Heizkosten rechnen, aus der Abhängigkeit von russischem Erdgas sind sie draußen.
Lust auf mehr Beiträge wie diesen?
⇨ Dieser Artikel stammt aus dem TGA-Planerjahrbuch 2025. Darin erwarten Sie folgende Highlights:
- Zukunftstrends: Grüner Wasserstoff, Gleichstrom, klimaneutrale Haustechnik, GEFMA 116 und künstliche Intelligenz – das erwartet die Branche
- Referenzen vom „Proton Therapy Center“ bis zum CO₂-neutralen Bürohaus
- Innovative Projekte: Gute Luft am Gletscher, chemiefreie Kalkschutzanlagen, kompakte Mischkreislösungen und weitere Leuchtturmprojekte
- Kreative Lösungen: Über das Gebäude als Energiespeicher, kontrollierte Wohnraumlüftung, kreislauffähige Badlösungen und vieles mehr
- Produktneuheiten
- Und natürlich: Der gesamte Firmenindex für Elektrotechnik, Installationstechnik, sowie Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Heizkosten von 80 Cent pro Quadratmeter
Ein Projekt, das einen Schritt weiter gegangen ist, ist das Wohnquartier Wientalterrassen im 14. Bezirk in Wien. Wie versorgt man einen Wohnbau mit 295 Wohnungen ohne Gas und Fernwärme und nutzt dabei die Sonne optimal? Das war die Frage des Bauherrn WBV-GPA und einer Arbeitsgemeinschaft von Architekt Christoph Lechner & Partner und dem Architekturbüro Berger+Parkkinen. Die Antwort war so innovativ, dass sie den ÖGUT Umweltpreis 2023 und den Österreichischen Betonpreis 2023 erhielt.
Die Wohnungen werden mit Sonne und Umweltwärme beheizt, insgesamt 140 unverglaste Solarabsorber am Dach (304 Quadratmeter) laden die Erdsonden, aus denen die Wärmepumpen ihre Energie ziehen. Die erneuerbare Wärme der 64 Tiefensonden mit jeweils 142 Meter und der insgesamt 330 kW Wärmepumpen wird über Bauteilaktivierung in den Wohnungen verteilt.
Eine Besonderheit des Projekts sind 150 Quadratmeter Asphaltkollektoren, die dem Asphalt vorm Haus die Sommerhitze entziehen und sie in die Tiefensonden leiten. Auch die Wärme des Abwassers wird genutzt, über einen Abwasserschacht wird mithilfe einer 136 kW Wärmepumpe der Energiebedarf fürs Warmwasser im Wohnquartier gedeckt. Die erneuerbare Energieversorgung sorgt bei den Mietern für Heizkosten von 80 Cent pro Quadratmeter und Monat, stabil für die nächsten Jahrzehnte.

Innovative Planung gefragt
Die Umsetzung der EU-Richtlinien wird im Laufe der Jahre 2025 und 2026 erfolgen, was einen neuen Markt für innovative Planer*innen eröffnet, um die gesetzlichen Vorgaben auf nationaler Ebene zu erfüllen. Eine klimafreundliche Haustechnik, welche die Sonne nützt, macht die Gebäude krisensicher und bietet den Bewohner*innen stabile Energiekosten über einen langen Zeitraum. Die Planer*innen und Handwerker*innen sind die Fachpartner der Kund*innen, um das praktisch umzusetzen. Jetzt ist die Zeit zum Handeln, packen wir's an!